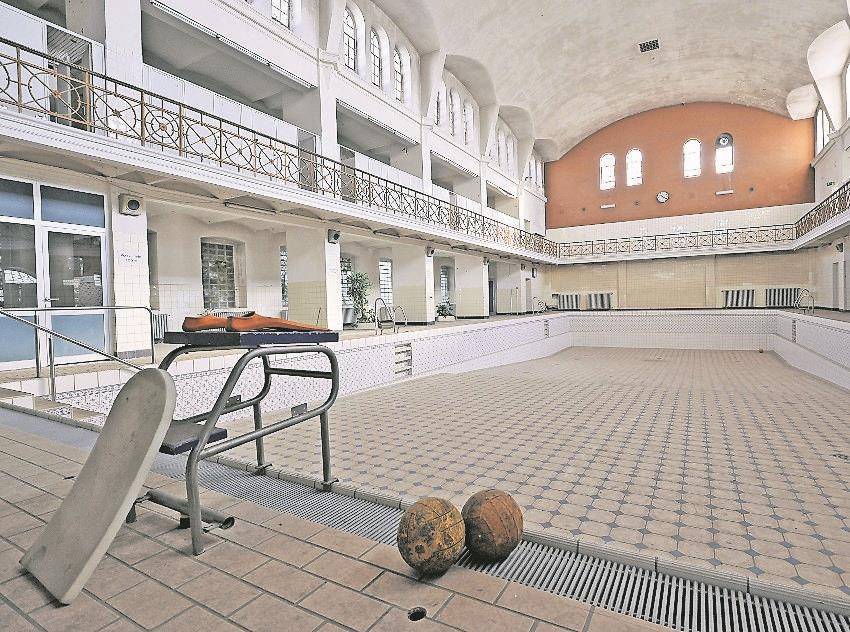Gastbeitrag Markus Schön: „Integration, dauernd und jetzt!“
Krefelds Zukunftsdezernent Markus Schön blickt in der WZ durch seine Krefeld-Brille.
Krefeld. Vor einigen Wochen kurz vor Einbruch der Dunkelheit in der Krefelder Innenstadt: Ein waschechter Bayer, den es beruflich an den Niederrhein verschlagen hat, sitzt mit seiner Kollegin, einer promovierten Psychologin und Lehrerin, die aus Palästina stammt, in einem türkischen Restaurant und feiert gemeinsam mit einigen Frauen und Männern mit türkischen Wurzeln sein erstes Fastenbrechen. Eingeladen hat ein Moscheeverein. Am Tisch sitzen unter anderem eine Erziehungswissenschaftlerin, die zugleich Ratsfrau ist, ein Soziologe, ein Facharbeiter in einem Chemiebetrieb, ein städtischer Beamter. Sie beten, singen, essen und kommen dabei ins Gespräch.
Ich finde das alles sehr interessant und fühle mich gleichsam gewertschätzt, ein Fest einer anderen Religion mitfeiern zu dürfen. Dabei denke ich so für mich, dass hier gerade unheimlich viel an Integration gelingt, weil man bei dieser Tischgemeinschaft des Iftaressens miteinander in Gespräch kommt und viel übereinander erfährt. Also nicht nur über Integration reden, sondern Integration, weil man miteinander redet!
Wobei: Wer redet dieser Tage eigentlich ernsthaft über Integration? Die politische Debatte in der Bundesrepublik ist seit Monaten vorwiegend geprägt von Aus- und Abgrenzungsrhetorik. Bayern führt eine eigene Grenzpolizei ein und der Bundesinnenminister hält mit seinem „Masterplan Migration“ wochenlang die Republik in Atem, lässt das Thema „Integration“ darin aber völlig außen vor. Dass das Zuwanderungsgeschehen einer (idealerweise europäischen) Regulierung bedarf, ist eine Selbstverständlichkeit. Genauso selbstverständlich muss es aber auch sein, das Zusammenleben aller in Deutschland Lebenden bestmöglich zu gestalten und zu organisieren. Integration ist eine Daueraufgabe und sollte vom ersten Tag an einsetzen, an dem jemand nach Deutschland kommt. Ob dabei Anker-Zentren auf der grünen Wiese fernab des gesellschaftlichen Miteinanders hilfreich sind, darf mehr als bezweifelt werden. Kommunen dabei mit Entlastungseffekten zu locken, klingt nur vermeintlich attraktiv. Denn wer 18 Monate oder länger in einer solchen Einrichtung verbracht hat, und dann einer Kommune zur Unterbringung zugewiesen wird, hat es 18 Monate versäumt, sich ein Bild vom Zusammenleben und den Gepflogenheiten, von den Werten und Chancen in unserem Land zu machen. Es bleibt dann wieder kommunale Aufgabe aufzuholen, was in diesen ersten anderthalb Jahren eines Aufenthalts in Deutschland versäumt wurde.
Da Integration sich um das Zusammenleben von Menschen dreht, ist sie Sozial- und nicht Ordnungspolitik. Wir in Krefeld haben uns bewusst dafür entschieden, Ausländerbehörde, Kommunales Integrationszentrum und den Migrationssozialdienst in einem Fachbereich zusammenzufassen, der in das Dezernat für Jugend, Bildung und Sport eingegliedert ist. Auch in anderen Kommunen wie Düsseldorf, Wuppertal oder Freiburg wird dieser Weg beschritten.
Was zählt neben diesen verwaltungsorganisatorischen Aspekten eigentlich zu den wesentlichen Aufgabenbereichen der Integration in den Kommunen? So projektbehaftet und zerfleddert die Finanzierung von Personal- und Sachmitteln durch Bund und Länder hier ist, kann man das schon einmal aus dem Blick verlieren. Im Wesentlichen geht es um Bildung, Heranführung und Eingliederung in den Arbeitsmarkt, aber auch um Themen aus dem Gesundheits- und Pflegebereich.
Im Bildungssystem, also von der Kita bis zum Einstieg in den Beruf, braucht es genügend Personal, das Sprachkompetenz und Migrationssensibilität aufweist. Zu denken ist an spezielle Sprachmittler und Schulsozialarbeiter, die dazu dienen, dass kein Kind im Unterricht zurückgelassen wird. Der Übergang in die Ausbildung muss mit einer Erklärung und Werbung für das duale Ausbildungssystem verbunden sein, das vielen Neuzugewanderten völlig unbekannt ist, was bedauerlicherweise oftmals zum Abbruch von Ausbildungen führt. Hier ist rechtzeitig vor Schulabschluss eine gemeinsame Kraftanstrengung von Schule, Kommunaler Beschäftigungsförderung und Wirtschaft gefragt. Im Übrigen sind die vielen Übergänge und Schnittstellen zwischen BAMF-Sprach- und Integrationskurs, Schule, Jobcenter, Arbeitsagentur und Ausbildungsbetrieb alles andere als selbsterklärend. Zugewanderten muss hier Orientierung in Form von Lotsensystemen gegeben werden, was durch Ehrenamtliche nicht geleistet werden kann.
Da ich persönlich „tief im Westen“ mittlerweile gut integriert bin, ende ich mit einem Zitat von Herbert Grönemeyer: Dieser hat nicht nur in einem Lied den Begriff „Heimat“ als Gefühl und nicht als Ort definiert, sondern seinem bislang letzten Studioalbum den Titel „Dauernd Jetzt“ gegeben. Und dauernd und jetzt ist auch die Mammutaufgabe der Integration von Bund, Ländern und Kommunen anzupacken!